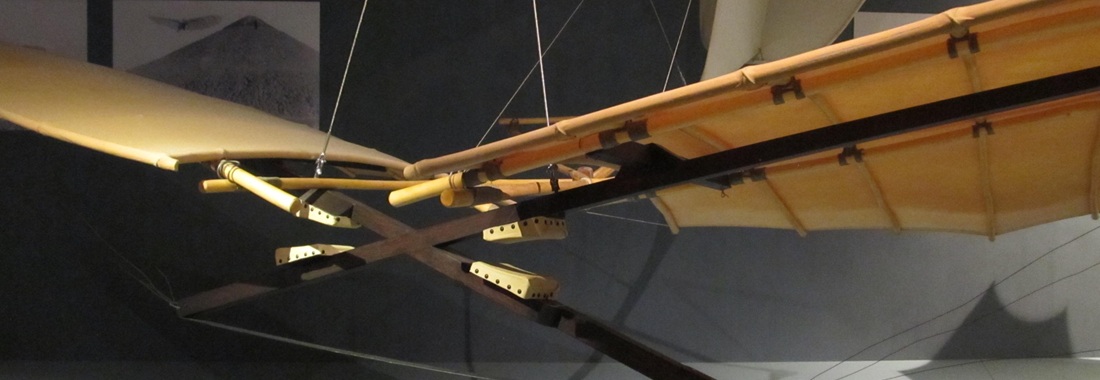Weit vor unserer Zeitrechnung, über das Mittelalter bis in das 18.Jahrhundert hinein, versuchten Menschen den Vögeln gleich durch die Luft zu gleiten. Beobachtungen des Vogelfluges und die daraus entstandenen Darstellungen der vielfältigsten Ideen und Fantasien zum Flug des Menschen, geben uns heute Informationen darüber, dass dieser Wunsch zu Fliegen so alt ist wie die Menschheit selbst.
Vor mehr als dreitausend Jahren entstand im alten Ägypten eine Darstellung auf einer Tür des Schreines, der die Mumie Tutenchamuns beherbergte. Die Figur stellt die mit Flügeln ausgestattet Göttin Isis dar. Bei den alten Persern, ca. 500 Jahre später, findet man auf einem Relief eines Palastes geflügelte Löwen mit Menschenköpfen, welche geschützt unter einer geflügelten Sonne wachen. Auch die Sage von Daidalos und Ikaros ist dem Leser mit Sicherheit bekannt. Sie konnten sich mit Hilfe selbst angefertigter Flügel aus der Gefangenschaft des Königs Minos befreien. Die Geschichte von Wieland dem Schmied, der sich selbst Flügel schmiedete und davongeflogen sein soll, ist ebenfalls ein Beispiel für die uralte Geschichte des Fluggedankens.
Erste Zeichnungen, Gemälde und Niederschriften zu diesem Thema wurden im Mittelalter angefertigt. So entstand auch die erste gedruckte Darstellung eines fliegenden Objektes. Es war der Holzschnitt eines unbekannten Künstlers aus dem Jahr 1489, der ein so genanntes „Luftschiff“ darstellte.
Hieronymus Bosch und seine fliegenden Schiffe
Im gleichen Jahr finden wir die Darstellung „fliegender“ Schiffe auf einem faszinierenden Kunstwerk von Hieronymus Bosch (ca. 1450 – August 1516). Der aufmerksame Betrachter wird auf dem Mittelteil des dreiteiligen Altargemäldes „Triptichon - Die Versuchung des heiligen Antonius“ mindestens fünf dieser vogelartigen „Luftschiffe“ vorfinden.
Auf dem oberen Teil des Gemäldes werden die „Luftschiffe“ am Himmel so dargestellt, als würden sie in kriegerischer Auseinandersetzung zu einander schweben oder aufeinander zufliegen. Handelt es sich hier um die erste Darstellung eines Luftkampfes? Beim genaueren Betrachten dieses Werkes könnte man mit viel Fantasie eine Lanze und einen Schild erkennen, sogar die Rauchwolken von Schusswaffen, oder waren es qualmende Antriebsmaschinen?
War es Fantasie oder gar eine Vision des Künstlers der voraussah, dass über 400 Jahre später in mörderischen Kriegen gewaltige Luftkämpfe ausgetragen werden würden. Oder war es sogar eine Prophezeiung, welche sich in schrecklicher Art und Weise bewahrheiten sollte? Der Glaube, die Fantasie und der sehnlichste Wunsch zu fliegen waren in dieser Zeit Antrieb für diese ausdrucksvollen Werke. Mit Wissenschaft hatte dies aber nichts zu tun.
Ein Boot mit Flügeln
Ein weiteres und besonderes Beispiel für die Gedanken über das Fliegen in der damaligen Zeit waren die Fantasien des Brasilianers Bartholomeo Lourenco de Gusmao (1685–1724). Er zeichnete ein Luftschiff, welches im Aussehen einem Vogel sehr ähnelte und ein Beweis dafür war, dass die Vorstellung mit einem vogelähnlichen Gerät durch die Luft zu fliegen, bis in das 18.Jahrhundert getragen wurde. Seine Vision war eine Mischung aus Vogel und Boot und hatte erstaunlicher Weise viel Ähnlichkeit mit den Gebilden, die Bosch bereits in seinem Kunstwerk verewigte.
Gusmao trug sein Projekt im April 1709 dem damaligen König von Portugal vor, pries es mit einer Vielzahl von Vorteilen an und bat um finanzielle Unterstützung für den Bau seines Flugschiffes. Aber ohne Erfolg.
Der damalige österreichische Botschafter in Portugal soll eine Abbildung und dazu gehörige Erläuterungen an den Wiener Hof gesandt haben. Dies erfuhr ein Wiener Journalist und machte daraus eine fantasievolle Geschichte. Eine Geschichte über einen Flug von Lissabon nach Wien, so geschrieben als wenn dieser tatsächlich stattgefunden hätte. Der Druck dieses Märchens brachte ihm wohl eine Menge Geld ein.
Die ersten Steuerelemente und eine geheimnisvolle Auftriebstechnik
Seine Passarola, so nannte Gusmao sein Gefährt, besaß auf jeder Seite des Rumpfes acht Ruder an deren Enden Vogelfedern befestigt waren. Damit sollte die das Gleichgewicht des Luftschiffes gewährleistet werden. Wie aber die koordinierte Bewegung der 16 Ruder vonstattengehen sollte, ließ er leider offen. Die senkrechte Flosse am Heck, ähnlich der eines Ruders bei Schiffen, sollte der Richtungsänderung dienen. Interessant aber war, dass der Auftrieb nicht durch einen Ballon, sondern durch „die angebliche Anziehungskraft des Bersteins und zweier geheimnisvoller Kugeln aus Magneteisenstein“ erzielt werden sollte. Eine doch, nach heutigem Wissenstand mehr utopische und wissenschaftlich nicht beweisbare Lösung. Gusmao soll aber nicht nur ein Phantast gewesen sein. Ihm werden Versuche mit kleinen Heißluftballons nachgesagt, die er erfolgreich am Hofe des Königs von Portugal durchgeführt haben soll. Selbst Versuche mit Gleitflugmodellen wurden aus seiner Schaffenszeit berichtet.
Kindermanns Luftbarke
Eberhard Christian Kindermann, seines Zeichens Kurfürstlich Sächsischer Hofprofessor und Astronom, war ebenfalls ein Vertreter der „Luftschiff-Phantasten“. Er verfasste im Jahre 1744 eine Schrift mit dem Titel „Die geschwinde Reise auf dem Luftschiff nach der obern Welt…“. In starker Anlehnung an den Entwurf der „Luftbarke“ des Grafen Lana di Terzi aus dem Jahr 1670 beschrieb er hier den Bau eines „Luftschiffes“ als Beleg dafür, dass er nicht ganz unwissend zum Thema „Fortbewegung in der Luft“ seiner Zeit war und alle bis dahin veröffentlichten Abhandlungen gut kannte und studiert hatte. Seinem handschriftlichen Manuskript „Physia sacra“ (Heilige Naturlehre) aus dem Jahre 1748 fügte er aber unwirkliche, utopische Zeichnungen hinzu, wie zum Beispiel seinen „Segelkahn“.
Dieser Kahn war so groß wie ein Ruderboot, ausgestattet mit zwei riesigen Vogelschwingen, einem gefiederten Schwanz und einem großen Segel um in der Luft mit dem Wind vorwärts zu treiben. Der Auftrieb sollte mit der Muskelkraft des Steuermannes durch Auf- und Abbewegen der Schwingen erfolgen.
Ähnliche Flugschiffe hat Bosch schon auf seinem Kirchenkunstwerk gemalt und das 250 Jahre vor Kindermann. Etwas richtig Neues ist hier also nicht zu Papier gebracht worden. Der Aufbau seines Segelkahns war sehr einfach gestaltet, denn alles wurde entweder der Natur oder bereits existierender Techniken aus dem Schiffbau entlehnt. Seine Gedanken und Vorstellungen waren reine Utopien. Sie wurden von ihm weder wissenschaftlich belegt noch hat er versucht diese technisch zu bewerkstelligen.
Trotzdem erfüllten sich Kindermanns Wunschträume und das Flugzeug sollte einige Hundert Jahre später das selbstverständlichste Fortbewegungsmittel für die Reise und den Transport durch die Luft sein.